Wohnen für Hilfe: "Kleines Baugebiet" im Altbau
Zwischenergebnisse aus dem Forschungsprojekt OptiWohn

Im Projekt „OptiWohn“ untersuche ich das Modell „Wohnen für Hilfe“ als eine Form des „flächenoptimierten Wohnens“: Meist wohnen junge Leute „zur Untermiete“ bei älteren Menschen, zahlen aber nicht normal, sondern helfen im Haushalt, beim Einkaufen oder im Garten. Es sind soziale Beweggründe, die zu dieser Wohnform führen: Die Älteren haben ein Bedürfnis nach Hilfe oder fühlen sich in einem großen Haus einsam. Die Jüngeren benötigen bezahlbaren Wohnraum. Durch dieses Geben und Nehmen wird – quasi als Nebeneffekt – bestehender Wohnraum besser genutzt, etwa frühere Kinderzimmer.
„Wohnen für Hilfe“ ist ein
ökonomisch, ökologisch und sozial erfolgreiches Modell, das den klassischen Dreiklang der Nachhaltigkeit erfüllen kann.
Als Wirtschaftswissenschaftler im Fachgebiet „Ökologische Ökonomie“ finde ich das Modell einerseits ökonomisch interessant, denn Neubau ist teuer. Dementsprechend lohnt es sich volkswirtschaftlich, vorhandenen Wohnraum neu zu nutzen. Andererseits ist das Modell auch ökologisch optimal, denn man vermeidet den Energieaufwand des Neubaus und braucht noch nicht einmal ein neues Baugebiet, verhindert also Flächenverbrauch. Deswegen nenne ich „Wohnen für Hilfe“ gerne auch das „Baugebiet im Altbau“. Wenn bislang die Energiewende bei Gebäuden untersucht wird, denkt man meist über sparsame Neubauten nach oder über eine höhere Modernisierungsquote im Altbau. Doch wenn Häuser von mehr Personen als vorher genutzt werden, dann wird auch die Raumwärme effizienter genutzt. Suffizienz der Fläche steigert also auch die Effizienz der Energienutzung. Darum hatte ich bereits als Sachbuchautor in den vergangenen Jahren diese Art der Untermiete gern geschildert – neben anderen Möglichkeiten, Wohnraum besser zu nutzen, wie Umbau und Umzug. Durch die wissenschaftliche Arbeit kann ich nun gründlicher erforschen, inwiefern „Wohnen für Hilfe“ einen Beitrag zur Wohnraumsuffizienz leistet.
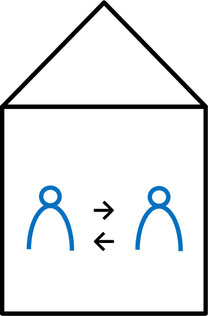
Neben diesen ökonomischen und ökologischen Argumenten fasziniert mich das Soziale bei „Wohnen für Hilfe“, schließlich ist es eine Form des Zusammenlebens verschiedener Menschen. Beim Kongress von „Homeshare International“ in Brüssel 2019 betraten zwischen den Fachvorträgen Wohnpaare die Bühne. Da berichtete zum Beispiel eine junge Frau, wie sie einen Platz zum Wohnen für sich fand und obendrein für ihr Cembalo. Aufgenommen hatte sie ein über 80 Jahre alter Mann, der zuvor alleine in einem großen Haus lebte und sich nun über Hilfe und Musik im Alltag freute. Dazu kam die Tochter des Mannes auf die Bühne und schilderte ihre Erleichterung: Seit ihr Vater nicht mehr allein lebe, mache sie sich weniger Sorgen um ihn.
Wie arbeiten die deutschen Vermittlungsstellen von „Wohnen für Hilfe“? Wie bringen sie diejenigen, die Wohnraum geben, mit denjenigen zusammen, die ihn suchen? Und unter welchen Bedingungen funktioniert das?
"Wohnen für Hilfe“ kann gelingen: Es gibt das Modell hierzulande seit dreißig Jahren, in mittlerweile über 30 Orten bundesweit. Welche Erfolge es erzielen kann, zeigt der internationale Vergleich. So werden allein in Brüssel jährlich 330 Alt-Jung-Wohnpaare vermittelt. In Deutschland gibt es gute Beispiele in Freiburg, Köln und München. Allerdings zeigt meine Untersuchung in Deutschland eine föderale Vielfalt der Träger und Organisationsformen, die mancherorts zu instabilen Verhältnissen führt und zu kleinen Vermittlungszahlen. Stabilität versprechen dagegen landesweite Netzwerke, das zeigen Erfolge in Belgien, Frankreich und Großbritannien.
„Wohnen für Hilfe“ braucht eine professionelle Mindestgröße: Der Vermittlungserfolg steigt relativ zur Größe der Vermittlungsstelle. So haben mittelgroße Stellen (mindestens 0,5 Vollzeitstellen) nicht doppelt, sondern viermal so viel Erfolg wie kleine Vermittlungsstellen. Große Organisationen wie in Brüssel können die Vermittlungschancen erneut verdoppeln. Dort werden je Vollzeitstelle 80 Wohnpaare jährlich vermittelt. Ähnliche Zahlen gibt es in Köln, wo die Vermittlung gebührenfrei erfolgt. In Großbritannien dagegen werden Gebühren fällig, dort gelingen je Vollzeitstelle 30-35 Wohnpaare pro Jahr.
„Wohnen für Hilfe“ kann sich langfristig selbst tragen: Der Aufbau einer neuen Vermittlungsstelle dauert drei bis fünf Jahre. Danach aber, so zeigt es das Beispiel Großbritannien, können sich die Vermittlungsstellen finanziell selbst tragen. Sie nehmen dort je 140 Euro/Monat von beiden Wohnpartner:innen. Gebühren sind in nahezu allen 17 internationalen Modellen von „homeshare“ (= “Wohnen für Hilfe“) üblich, doch in Deutschland wird es als weitgehend gebührenfreies Zuschussmodell betrieben.
„Wohnen für Hilfe“ schafft Wohnraum im Altbau und gute Nebeneffekte: Die von einer Vermittlungsstelle in einer Großstadt untergebrachten 30 – 50 jungen Menschen würden sonst anderswo nach Wohnraum suchen, zum Beispiel müsste für sie ein Studierendenwohnheim neu gebaut werden. Das überflüssig zu machen, ist ein ökonomischer Erfolg, doch er bringt weitere Vorteile. Ökologisch betrachtet vermeidet das Modell den Energieaufwand des sonst erforderlichen Wohnheimbaus. Sozial ist „Wohnen für Hilfe“ ohnehin, denn es vermeidet Einsamkeit und verbindet Generationen.
Weiterführende Links:
Mehr von Daniel lest ihr auf seine Website www.daniel-fuhrhop.de.
Autor:innen:

Daniel Fuhrhop
Daniel Fuhrhop ist Betriebswirt, war 1998-2013 Architekturverleger (Stadtwandel Verlag) und forscht im Rahmen von OptiWohn an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Ökologische Ökonomie) vor allem zu “Wohnen für Hilfe”. Als Autor der Streitschrift “Verbietet das Bauen!” und des Ratgebers “Einfach anders wohnen” zeigt er, wie sich unser Bauen und Wohnen radikal ändern kann.
